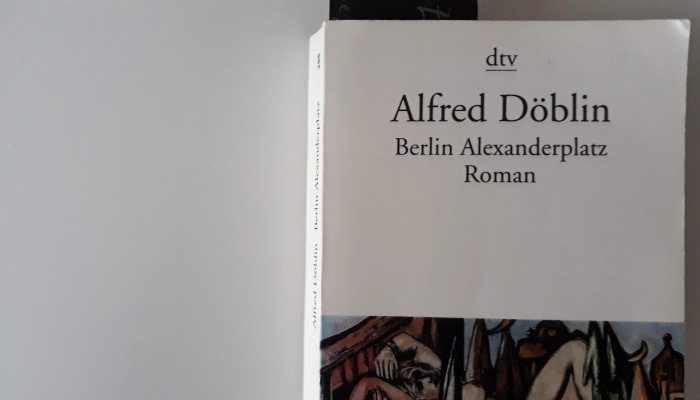
Vor wenigen Tagen bin ich (mal wieder) über eine Liste von Büchern gestolpert, die man gelesen haben MUSS. Eine bekannte Buchhandelskette hatte sie zusammengestellt. Man warf ihr daraufhin in sozialen Medien vor, nur an den Verkaufszahlen schrauben zu wollen. Nun, dass in diesem Zusammenhang an Werbung gedacht worden ist, kann man wohl nicht von der Hand weisen, dennoch machte die Liste nicht den Eindruck nur eine Sammlung an Ladenhütern zu sein, die endlich aus den Regalen der Filialen und Lager verschwinden sollten.
Damit habe ich mich aber schon verraten: Ich blättere mich gerne durch solche Listen (und in dem Fall waren es stattliche 99 Titel). Vielleicht ein wenig aus Eitelkeit (was ich nicht alles schon gelesen habe), aber der wesentliche Hintergedanke dabei ist, Bücher bzw. Autoren zu entdecken, die mir bisher entgangen sind (und, ja, in diesem Sinne war die Liste hilfreich).
Dennoch, was man alles gelesen haben muss, das trifft nicht notwendigerweise jeden Geschmack. Deshalb ist mir „MUSS“ dann doch zu viel. Selbst „SOLLTE“ ist mir didaktisch zu hoch gegriffen.
Komm endlich zum Punkt, mag der geneigte Leser denken! – Gerne!
Eines der Bücher, die unverzichtbar für das literarische Ego zu sein scheint und das immer wieder in solch einem Zusammenhang genannt wird (auch von Menschen, die ich sehr schätze), ist Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“. Und da ich zu diesem Zeitpunkt gerade mitten in dem Roman steckte (auch getrieben durch derartige Aufforderungen), will ich es wagen und einen gewissen Druck vom Listenbetrachter nehmen. Muss man den Roman tatsächlich gelesen haben? – Ich finde: Nein.
Wie komm ich dazu so etwas zu behaupten? Am epochalen Werk Döblins zu rütteln? Man kann es ja gerne lesen, aber ich würde es eben nicht empfehlen. Und dabei liegt es nicht am Anspruch. Ich mag anspruchsvolle Literatur und Lenz, Camus, Samarago, Böll, Gide gehören zu meinen absoluten Lieblingsautoren (um nur einige in beliebiger Reihenfolge zu nennen). Als „seicht“ würde ich sie alle nicht bezeichnen, der Verdacht der Trivialliteratur kommt wohl bei keinem auf. Es liegt ebenso wenig am Alter der Textes (mich hat letztes Jahr „Effi Briest“ einfach nur begeistert) oder am Schauplatz und dem Genre des Großstadtromans („Jeder stirbt für sich allein“ fand ich so gnadenlos wie fesselnd).
Warum also nicht „Berlin Alexanderplatz“?
Ich bin einfach nicht warm geworden mit dem Text und ich kann mir schwer vorstellen, wie das funktionieren soll. Gut, literarische Goldgräber mit viel Muse und Geduld mögen aus dem Roman vielleicht den einen oder anderen Nugget bergen, der mir im Wust verborgen geblieben ist. Mir waren es am Ende zu viele Einwürfe neben der Handlung, und damit meine ich nicht die Beschreibung des Alltags im Berlin von 1928 (die Schlachthof-, Gerichts- oder andere Szenen, die entstehen und wieder verschwinden). Eher denke ich an seitenlange Abschweifungen und Wiederholungen, die nicht zur Klarheit des Textes beitragen wollen. Ich gebe zu, ich habe die eine oder andere Beschreibung entnervt übersprungen. Nicht nur einmal musste ich an das Lektorat meiner Bücher denken, wenn mir der Zug in der Handlung fehlte.
Darüber hinaus ist der Roman (und damit kann ich selten gut umgehen) über weite Bereiche im Dialekt verfasst, in dem Fall der Berliner Schnauze der Gosse, mit allen grammatikalischen und inhaltlichen Konsequenzen. Das kann man mögen, authentisch oder sprachwissenschaftlich interessant finden, mir vermiest es eher die Laune beim Lesen (ein Grund, warum ich beispielsweise auch mit „Kolks blonde Bräute“ bei aller Sympathie nicht zurecht gekommen bin).
Und ein Geständnis muss ich noch machen: Wenn mir der Text zu konfus geworden ist, dann hab ich auf Wikipedia die einzelnen Abschnitte nachgelesen. (Denn beispielsweise wurde mir meine Unkenntnis des entscheidenden Begriffes „Lude“ anfangs zum Verhängnis. Aber selbst schuld, hätte ich ja gleich nachschlagen können.)
Dennoch habe ich den Roman bis zur letzten Seite gelesen. Verschwendete Lebenszeit? Bedingt. Irgendwie wollte ich dann doch wissen, welches Ende es mit Franz Bieberkopf nimmt. Wurde ich enttäuscht? Ging kaum mehr.
Und tatsächlich weggelegt habe ich in meinem Leben nur ganz wenige Bücher. Eines habe ich noch im Kopf, eines, dessen Parallelen zu „Berlin Alexanderplatz“ ganz offenkundig sind (und die schon kurz nach der Veröffentlichung Alfred Döblin zu einer Stellungnahme nötigten): James Joyce „Ulysses“.
Und natürlich war „Ulysses“ auch unter den 99 Titeln, die man gelesen haben muss.
Also, wenn Listen künftig suggerieren wollen, was in keinem Bücherregal fehlen darf: Ehrlich, ich würde weder Joyce noch Döblin vermissen.